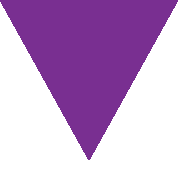Commemorating the victims
Warning to the generations

Anna Emilie Stadtegger (geb. Zötl)
Anna Emilie Zötl wird am 25. Februar 1912 in Wien geboren, nur 5 Tage nachdem ihre Eltern, der Färbermeister Emil Karl Zötl und Anna Eglauer die Ehe geschlossen haben. Sie entgeht somit knapp dem Makel, ein uneheliches Kind zu sein. Ihre Eltern stammen beide aus dem kleinen Markt Gutau, der damals zur Herrschaft Freistadt gehört. Sie kehren bald darauf dorthin bzw. nach Freistadt zurück und bekommen danach noch vier weitere Töchter, von denen die zweite, Emilie, im Jahr 1916 im Alter von nur 3 Monaten stirbt. Irgendwann nach der Geburt der jüngsten Tochter Friederike (geboren am 4.12.1923) übersiedelt die Familie schließlich nach Wels.
Kontakt mit Jehovas Zeugen
Anna ist gerade einmal 18 Jahre alt, als sie mit Jehovas Zeugen – damals noch Internationale Bibelforscher-Vereinigung genannt – in Kontakt kommt. Sie erkennt, dass zwischen den Lehren der römisch-katholischen Kirche und den Aussagen der Bibel erhebliche Diskrepanzen bestehen und tritt deshalb konsequenterweise am 2. April 1930 – am gleichen Tag wie ihre Mutter – aus der Kirche aus. 1931 lässt sie sich als Zeugin Jehovas taufen. Die Versammlungen von Jehovas Zeugen, an denen jeweils zwischen 20 und 30 Personen teilnehmen, finden im Gasthaus „Zur Stadt Passau“ in der Schubertstraße 2, 4600 Wels statt. Anna lernt dort Egmund Andreas Stadtegger kennen und heiratet ihn am 28.12.1931. Er ist bei den Versammlungen bis 1934 für den Büchertisch zuständig, das Hauptlager der Bücher ist bei ihm zu Hause. Er gibt zwar später gegenüber der Gestapo an, dass es 1934 aufgelöst worden sei, laut Angaben seiner Schwiegermutter leitet er aber noch bis Mai 1940 Schriften an sie und andere Glaubensbrüder weiter.
Verbot unter dem ständestaat
Aufgrund des Verbots von Jehovas Zeugen in Österreich (1934/35) ist es nicht mehr möglich, sich weiter im Gasthaus „Zur Stadt Passau“ zu treffen. Interessierte holen sich ihre Literatur daher zunächst direkt bei den Stadteggers in der Alois-Auer-Straße 16 in Wels ab – eine Vorgangsweise, die schon zu dieser Zeit nicht ungefährlich ist, da der Besitz der Druckschriften verboten ist. Manche Glaubensbrüder, so z.B. auch Leopold Engleitner, kommen in der Nacht und legen oft weite Strecken mit dem Fahrrad zurück, weil das Benützen der Eisenbahn zu gefährlich und die Polizei bereits aufmerksam geworden ist. Das tut jedoch der Begeisterung der beiden keinen Abbruch. Sie sind tief davon überzeugt, dass sie den rechten Glauben – die Wahrheit aus Gottes Wort – gefunden haben und stehen voll und ganz hinter dieser Überzeugung. 1936 besuchen Anna und Egmund einen Kongress in Luzern, der sie weiter in ihrem Glauben bestärkt. Dabei knüpfen sie offenbar auch weitere Kontakte zu den Glaubensbrüdern in der Schweiz und werden von Mitarbeitern des „Berner Zentraleuropäischen Büros“ auf die in Hitler-Deutschland bereits übliche Verfolgung vorbereitet. Wahrscheinlich erhalten sie auch bereits erste Anweisungen für die illegale Arbeit.
Während der NS-Zeit
Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 11. März 1938 verschärft die Lage von Jehovas Zeugen weiter. Alle Gesetze, die in Deutschland nur schrittweise in Kraft getreten sind, werden in Österreich rasch umgesetzt. Damit können politische Gegner und Jehovas Zeugen in „Schutzhaft“ genommen und auch ohne gerichtliche Verurteilung in Konzentrationslager eingeliefert werden. Im Frühjahr 1938, kurz vor dem Einmarsch der deutschen Truppen, lernen die Stadteggers über Vermittlung von Glaubensbrüdern in Freistadt den deutschen Missionar Ernst Bojanowski kennen, dem sie für einige Wochen Unterkunft und Verpflegung gewähren, bevor er in die Schweiz weiterreist. Anna bleibt auch danach mit ihm in brieflichem Kontakt. Sie bedienen sich dabei einer Geheimschrift, die Bojanowski erfunden hat. Bei unverfänglichen Dingen benutzen sie die normale Schreibschrift, wenn es um heiklere Angelegenheiten geht, verwenden sie die Geheimschrift, so z.B. als Anna ihm zwei Pakete ankündigt, die er „genau durchsehen“ soll. In einem ist die Seitenwand so präpariert, dass darin ein „Wachtturm“ versteckt werden kann, der Rest des Pakets ist mit Äpfeln gefüllt, das andere enthält eine Damenjacke, auf deren innerem hellem Futter der Text eines „Wachtturms“ abgeschrieben ist. Anna engagiert sich als Kurierin, um Glaubensbrüder in ganz Österreich mit Literatur zu versorgen, wobei sie mit äußerster Vorsicht vorgehen muss, zumal ihr Mann Egmund bereits von der Gestapo überwacht wird. Den Behörden fallen die beiden auch deshalb auf, weil sie nicht an der Volksabstimmung teilnehmen, die die Nationalsozialisten am 10. April 1938 im gesamten Deutschen Reich zur nachträglichen Legitimierung des Anschlusses abhalten. In der Folge wird Egmund Stadtegger von 11. Juli bis 2. August 1938 und dann gleich wieder, von 3. bis 22. August 1938 wegen seiner Tätigkeit als Zeuge Jehovas bzw. seiner Verbindung zur Internationalen Bibelforscher-Vereinigung im Polizeigefängnis Linz in Schutzhaft genommen.
ANNA ARBEITET TROTZ VERHAFTUNG IHRES MANNES heimlich weiter für ihre Glaubensbrüder.
Im Herbst 1938 und im Jänner/Februar 1939 sowie im Mai 1939 unternimmt sie Reisen, die sie über Graz nach Klagenfurt und Lienz, aber auch nach Molln, Braunau, Salzburg und Innsbruck bis nach Dornbirn führen. Dort übernimmt sie Literatur aus der Schweiz zur Weiterleitung und Verteilung in Österreich. Am 25. Mai 1939 wird in Wien der Landesdiener August Kraft festgenommen. Anna hat ihn schon seit 1937 bei seiner Tätigkeit unterstützt und ist dadurch mit der österreichischen Organisation vertraut. Sie übernimmt nun seine Aufgabe. Am 6. Juni 1939 reist sie nach Berlin zu Ernst Bojanowski, dem sie 10 Ausgaben des „Wachtturms“ (teils Originale, teils Abschriften) und ein Buch bringt, damit dieser sie an Glaubensbrüder weiterleiten bzw. verborgen kann.
Festnahme und Schutzhaft im KZ Ravensbrück
Am 20. Juni 1939 wird Anna Stadtegger in Wien festgenommen. Einen Monat später, am 20. Juli 1939, wird sie als Schutzhäftling ins KZ Ravensbrück überstellt. Sie erhält die Häftlingsnummer 2016 mit dem Lila Winkel der „Bibelforscherinnen“. Von nun an wird sie nur noch mit dieser Nummer angesprochen. Das Leben im Lager ist geprägt von Hunger, Gewalt und entwürdigenden Zuständen. Die Frauen müssen schwere Zwangsarbeit leisten, mit minimaler Verpflegung und ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit.
Der Lageralltag
Der Tag beginnt um 4:30 Uhr. Die inhaftierten Frauen werden durch eine Sirene geweckt, es bleiben nur wenige Minuten, um sich in einem der wenigen Waschbecken zu waschen, das Bett zu machen und sich um ein Frühstück anzustellen, das lediglich aus Ersatzkaffee besteht. Eine Insassin erinnert sich: „Es war hellgelbes Wasser, das ich nur deshalb trank, weil man das ungekochte Wasser wegen der schlechten Leitung und Kanalisation nicht trinken konnte. Wer es trotzdem tat, wurde krank und konnte daran sterben.“ Nach dem Zählappell um 5:00 Uhr geht es zur Zwangsarbeit – bis zu einer kurzen Mittagsrast mit Wassersuppe und einer Brotration – danach wieder Zwangsarbeit, anschließend zurück ins Lager zum Abendappell, der auch mehrere Stunden dauern kann. Anschließend „Freizeit“ – die Frauen fallen todmüde ins Bett. Die Lebensbedingungen in diesem Konzentrationslager werden als katastrophal, ja als Albtraum beschrieben. Die Baracken sind völlig überbelegt, zwei bis drei Frauen müssen sich ein Bett teilen. In Ravensbrück steht von Anfang an die wirtschaftliche Ausbeutung der Häftlinge
Aktives Glaubensleben und Standhaftigkeit
Erklärtes Ziel der Gestapo und der SS ist es, das widerständische Verhalten und den Glauben der Zeuginnen Jehovas zu brechen und sie somit wieder zu „brauchbaren Bürgerinnen“ des NS-Staates zu machen. Besonders perfide ist das Angebot der SS, sie umgehend aus dem Konzentrationslager zu entlassen, wenn sie die so genannte „Erklärung“ unterschreiben, was jedoch dem Abschwören ihres Glaubens gleichkäme. Trotz der ständigen Misshandlungen im KZ geben nur wenige dieser Versuchung nach. Wegen ihrer Pflichttreue, ihrer Ehrlichkeit und ihrem Arbeitseifer werden die Zeuginnen Jehovas bald zu den begehrtesten Arbeitskräften. Sie verweigern allerdings standhaft und solidarisch vor allem die Arbeit in der Rüstungsproduktion bei der Herstellung von Waffen und anderem Kriegsgerät. Anna Stadtegger gehört auch zu den 450 Zeuginnen Jehovas, die sich im Dezember 1939 weigern, Kriegsmaterial zu fertigen (Patronentaschen zu nähen) und werden daraufhin von dem wutentbrannten Lagerkommandanten Max Koegel in den erst halbfertigen Arrest (Zellenbau) gesteckt. Sie müssen dort unter freiem Himmel in Kleidern mit kurzen Ärmeln bei Schnee und Eiseskälte ohne Mittagessen bis 6 Uhr abends stehen. In der Nacht werden sie zu zwölft in Zellen gesperrt, die normalerweise für ein bis zwei Häftlinge gedacht sind. Es wird ihnen alles entzogen – die Heizung, das Bett, sie haben keine Decken, alle Jacken werden ihnen weggenommen. Statt eines Abendessens gibt es nur Beschimpfungen. Am nächsten Tag müssen sie wieder ins Freie und den ganzen Tag in der eisigen Kälte stehen, besser gesagt, die ganze Zeit mit den Füßen trippeln, damit die Füße im Lauf des Tages nicht erfrieren. Das wiederholt sich sechs Tage. Während der Weihnachtsfeiertage „vergisst“ man auf die Zeuginnen Jehovas, sie bekommen weder Essen noch Trinken. Danach geht die gleiche Bestrafung bis über die Neujahrsfeiertage hinaus weiter. Dennoch bleiben alle 450 standhaft. Nach etwa drei Wochen werden sie zurück in die Baracken gebracht, in denen es allerdings so kalt ist, dass sie innen völlig vereist sind. Noch bis März 1940 werden besondere Strafblockverfügungen verhängt, so werden die Zeuginnen Jehovas für jede schwere Arbeit herangezogen – auch sonntags, wenn andere Häftlinge arbeitsfrei haben. Als Folge magern sie bis auf das Skelett ab. Im Februar 1940 wird Ernst Bojanowski in Dresden festgenommen. Anlässlich seiner Verhöre durch die Gestapo gibt er Details im Zusammenhang mit der Organisation von Jehovas Zeugen sowie Namen und Adressen von Glaubensbrüdern preis, was maßgeblich dazu beiträgt, dass das Reichssicherheitshauptamt per Erlass vom 6. Juni 1940 eine reichsweite Verhaftungswelle der bekannten Bibelforscher für den 12. Juni 1940 anordnet. An diesem Tag werden 45 Zeugen Jehovas in Wien, 17 in Oberösterreich, 14 in Tirol usw. verhaftet, darunter auch Annas Mann Egmund, der am 4. Dezember 1940 zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt wird. Er wird jedoch nach der Haftverbüßung nicht freigelassen, sondern ins Zuchthaus Siegburg verlegt. Anfang 1945 bricht dort eine Fleckfieberepidemie aus, was ein Massensterben unter den Insassen zur Folge hat. Am 21. Februar 1945 stirbt auch Egmund Stadtegger – wahrscheinlich ebenfalls an Fleckfieber.
Überstellung nach Linz
Anna Stadtegger wird im Zusammenhang mit den Festnahmen vom 12. Juni 1940 am 15. Juni 1940 nach Linz überstellt und nach ihrer Ankunft am 21. Juni für ein weiteres Verhör ins Polizeigefängnis gebracht. Gegenstand dieser Befragung sind insbesondere ihre Reisen in der „Ostmark“. Anna macht allerdings nur vage Angaben, nennt immer nur die Vornamen der Personen, die sie dabei getroffen hat und gibt an, die Familiennamen gar nicht zu kennen. Im Vernehmungsprotokoll vom 18. Juli 1940 wird festgehalten: „Die Stadtegger will Namen grundsätzlich nicht nennen und bekennt sich nach wie vor als Zeugin Jehovas ...“. Wahrhaft eine mutige und standhafte Frau, auch wenn sie von ihrer äußerlichen Erscheinung her gar nicht so außergewöhnlich wirkt. Es ist uns zwar kein Foto von ihr erhalten, aber auf Grund der Beschreibung auf den „Transportzetteln“, also den Überstellungsbestätigungen vom KZ ins Polizeigefängnis und zurück, können wir sie uns in etwa so vorstellen: mit 162 cm nicht allzu groß, schlank, ovales Gesicht, blond, blaue Augen, die eine oder andere Zahnlücke – wahrscheinlich eine Folge der Mangelernährung und der schlechten Hygiene im Konzentrationslager. Nach ihrer Vernehmung am 18. Juli 1940 wird Anna Stadtegger ins KZ Ravensbrück zurückgeschickt.
Zurück im KZ Ravensbrück
Anfang 1942 beginnen unter den Zeuginnen Jehovas Debatten, welche Tätigkeit Kriegsarbeit sei und dabei wird nicht mehr einheitlich entschieden. So bilden sich schließlich drei Fraktionen, die als „die Extremen“, die „schwankende Mitte“ und „die Gemäßigten“ bezeichnet werden. Wer als „Extreme“ oder „Gemäßigte“ gilt, hängt vor allem mit dem zugeteilten Arbeitskommando zusammen. Einige verweigern nun z.B. die Versorgung der Kaninchen, da sie meinen, die Wolle werde für Soldatenbekleidung verwendet, andere wiederum die Arbeit in der Gärtnerei, da das Gemüse an ein SS-Lazarett gesandt wird. Noch im Jänner 1942 eskaliert die Situation. Etwa 90 Zeuginnen Jehovas werden wegen ihrer Arbeitsverweigerung zu Bunker und Dunkelarrest verurteilt und bei eisiger Kälte ohne Jacken, ohne Decken und ohne jegliche Sitzgelegenheit in dunkle Barackenräume gesperrt. Sie erhalten eine Ration Brot und alle 4 Tage Essen, dann noch zusätzlich 25 Stockhiebe. Nach 40 Tagen sind sie wandelnde Skelette und machen den Eindruck von Geisteskranken.
Die Hinrichtung
Es ist nicht bekannt, welcher der drei Fraktionen Anna Stadtegger zuzuordnen ist, wenngleich vor allem Österreicherinnen zu den „Extremen“ zählen. Außer für die Weigerung, den Krieg auch nur in geringster Weise zu unterstützen, drohen auch für andere Vergehen grausame Strafen. So finden z.B. einige Insassen den Tod durch den Strang, weil es ihnen gelungen ist, Bücher und Traktate ins Lager zu schaffen. Möglicherweise ist genau das der Grund dafür, dass auch Anna Stadtegger im September 1943 erhängt wird. Sie ist zum Zeitpunkt ihrer Hinrichtung gerade einmal 31 Jahre alt
© 2026 Purple Angle Association - All rights reserved